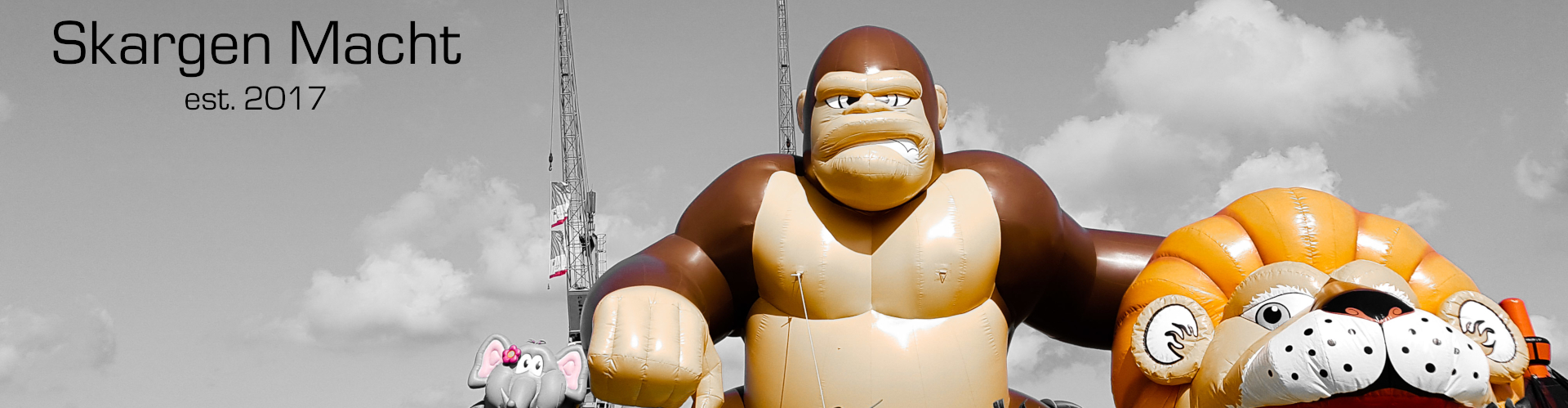Geschmacklosigkeiten – Teil 1.
Über Geschmack lässt sich vorzüglich streiten. Über Geschmacklosigkeiten eindeutig nicht. Ist etwas gesellschaftlich nicht akzeptiert ist man sich schnell einig, über den oder die Übeltäter. „Sowas geht nicht !“, heißt es dann oft in der Runde. Aber wo fängt das „geht nicht“ an und ab wo beginnt „geht gar nicht“? Was ist der Unterschied? Kann etwas noch weniger als „nicht gehen“?
Ein paar klassische Beispiele für „geht!“ (gesellschaftlich akzeptiert/geduldet):
- Ein Banker zieht, nach einer durchfeierten Nacht, eine Line Koks durch einen 500-Euro Schein von dem Venushügel einer Prostituierten.
- Die hübsche Nachbarin trinkt jeden Abend eine Flasche Wein. Manchmal auch eineinhalb.
- Der Chef geht zwanzig Mal am Tag raus zum Rauchen.
Ein paar klassische Beispiele für „geht nicht!“ (gesellschaftlich nicht geduldet):
- Ein Arbeiter kotzt nach dem 15. Bier und dem 15. Korn, gegen die Hauswand der Eckkneipe.
- Die hübsche Nachbarin raucht jeden Abend Gras auf ihrem Balkon.
- Der Chef hat jeden Tag einen Kater und riecht im Aufzug nach Minzbonbons und Bierfahne.
Ein paar klassische Beispiele für „geht gar nicht!“ (gesellschaftlich geächtet):
- Ein gammeliger Penner kocht in einem Löffel Opiate für seinen nächsten Schuss auf.
- Die hübsche Nachbarin hat jeden Abend Besuch von 3 bis 4 Männern.
- Der Chef wird auf der Toilette mit einer Flasche Vodka erwischt. Mittwoch Morgens um halb 10.
Ist etwas gesellschaftlich nicht geduldet, hat fast immer ein Anderer negative Konsequenzen durch die nicht geduldete Handlung. „Du kannst dich selbst zerstören, aber bitte bleib mir dabei vom Leib.“, ist wohl der gängige Gedanke. Erbringt jemand selbstverschuldet, seine vom Umfeld verlangte Leistung nicht, oder nur eingeschränkt, ist dies ebenfalls gesellschaftlich nicht geduldet. Denn es schadet der Gesellschaft – zumindest ein Bisschen.
Wenn etwas „gar nicht geht“, betrifft es häufig Handlungen, die dem Individuum die Teilnahme und die Teilhabe an der Gesellschaft absprechen. Hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Ist jemand am Boden der Gesellschaft angelangt, verursacht diese Person unweigerlich Kosten für das Sozialsystem. Um aus Gründen der Moral und bei Verstoß gegen die geltenden Werte, aus einer Gesellschaft zu fliegen, ist hingegen etwas schwieriger. Des Weiteren werden bei solchen Handlungen, nicht zwangsläufig Dritte geschädigt.
Die individuelle Freiheit stößt also unweigerlich an Ihre Grenzen, so man sich als Mitglied einer Gesellschaft sehen möchte. Die Menschheit hat über jahrtausende gelernt, dass es förderlich ist, in Gruppen zu leben. Zu einem selbstbestimmten Leben in einer Gruppe, gehört zum Einen, mit der individuellen Einschränkung zu Leben und zum Anderen eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber zu haben.
Aktuell ist es geschmackvoll die Ängste Anderer zu ignorieren, um ganz geschmacklos die eigenen Ängste mit Konsum und Drogen zu überspielen und zu leugnen.
Ein freier Mensch zu sein, birgt mehr, als nur das zu Tun und zu lassen was man möchte. Die Verantwortung gegenüber der depressiven, hübschen Nachbarin, ist genauso gegeben wie die gegenüber sich selbst. Freiheit entsteht an dem Punkt, an dem man seine eigenen Ängste und Probleme analysiert und behoben hat und nicht mit dem Ausstieg aus einer Gesellschaft.
Wer frei sein möchte, kümmert sich um seine eigenen Probleme und Ängste und öffnet dann die Augen für die Probleme und Ängste der Menschen in seiner sozialen Gruppe.